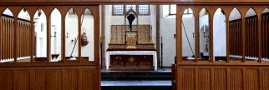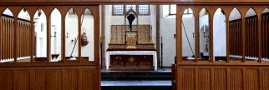-
Einen wichtigen Bestandteil des Kirchenjahres bilden die Heiligenfeste. Gleichwie am Firmamente die alles beherrschende Sonne vom Mond begleitet und von ungezählten Sternen verschiedener Größe umgeben erscheint, so sind in den Kreis des Kirchenjahres, das sich um die geistige Sonne, um Christus, bewegt, mannigfaltige Feste der Mutter Christi und seiner Heiligen eingestellt. Wie der Mond und die Sterne unseres Sonnensystems all ihr Licht vom Glanze der Sonne empfangen, so erstrahlen auch alle diese Heiligen von jenem Gnadenlichte, das sie von Christus empfangen. Deshalb ist die liturgische Heiligenverehrung der katholischen Kirche im Grunde genommen nichts anderes als eine Ehrung Christi.
An diesen Festen ehrt die Kirche die Heiligen als die bewährten, nun ewig verklärten Freunde Gottes, als die erprobten Ahnen und Helden des Gottesreiches und als Vorbilder eines auf Gott eingestellten Lebens. Auch empfiehlt sie sich im Vertrauen auf ihre Verdienste ihrer Fürsprache am Throne Gottes.
Die Heiligenfeste sollen in uns die «Gemeinschaft der Heiligen» zu einer innigen, fruchtbaren Seelen- und Geistesgemeinschaft werden lassen. Wie die Liturgie die Heiligen niemals für sich allein ehrt, sondern nur in ihrer übernatürlichen Lebensverbindung mit Christus, dem Haupte, und mit dessen Gliedern, vor allem der streitenden Kirche auf Erden, so müssen auch wir uns eins fühlen mit ihnen. Wir dürfen unsre Gebete und Opfer, durch ihre Verdienste und Genugtuungen verstärkt, vor Gottes Thron bringen. Freilich kann das eucharistische Opfer nur Gott dargebracht werden, es darf aber nach der Lehre des Konzils von Trient auch zu Ehren der Heiligen gefeiert werden, um Gott für die von ihnen errungenen Siege zu danken und ihre Fürbitte zu erflehen. Dieser Dank ist eigentlich nur eine Anerkennung der Liebe, Güte und Allmacht Gottes, die sich an den Heiligen so vollkommen bewährt hat. Wir suchen uns ihre Fürsprache zu sichern, und zwar «durch Christus, unsern Herrn», in dem die Fürsprache der Heiligen ihren letzten Grund hat, weil er der einzige Mittler ist zwischen Gott und den Menschen (2 Tim. 2, 5).
Die Heiligenfeste haben das Eigentümliche, daß sie nicht etwa am irdischen Geburtstage des Heiligen gefeiert werden, sondern am Todestag. Dieser ist nämlich nach der uralten Anschauung der Kirche der Geburtstag der Heiligen fürs ewige, himmlische Leben, der Tag, an dem ihnen «der sanfte und festfrohe Anblick» ihres Erlösers aufging und das Fest der Ewigkeit anbrach.
Wenn die Kirche die Heiligen durch einen eigenen Kranz von Festen ehrt, so ist das nur eine Entfaltung der Heiligenverehrung bei jeder heiligen Messe; denn öfters läßt die Kirche ihre Priester am Altare liebreich der Heiligen gedenken; so zweimal im Kanon: in den Gebeten «Communicantes» und «Nobis quoque peccatoribus», dann nach dem Vaterunser im Gebet «Libera».
-
Es war in der Frühzeit der Liturgie Brauch, die Heiligen am Jahrestag ihres Heimgangs, und zwar ursprünglich nur am Orte des Todes oder der Grabesruhe, in festlichem Gottesdienste zu ehren. Nach und nach dehnte sich deren liturgische Verehrung auch auf andere Kirchen und Länder aus. Einige der Heiligen, die für die ganze Kirche von besonderer Bedeutung waren, z.B. die jungfräuliche Gottesmutter Maria, der hl. Johannes der Täufer, der Erstlingsmartyrer Stephanus, die Apostelfürsten Petrus und Paulus, wurden gleich vom Anfang ihrer liturgischen Verehrung an in der ganzen Kirche geehrt.
Am frühesten genossen liturgische Verehrung jene Heiligen, die dem Herrn, sei es im Leben durch Verkündigung des Christentums, sei es vor allem im Tode, besonders ähnlich geworden waren: die Apostel und Martyrer. Schon in der Mitte des 3. Jahrhunderts stand in Rom die Verehrung der heiligen Martyrer in hoher Blüte: schon damals bildete neben dem Gedanken der Verehrung auch der Fürbittgedanke einen festen Bestandteil des Kultes der Martyrer.
Nach der Heldenzeit der Christenverfolgungen dehnte sich im 4. Jahrhundert die Heiligenverehrung auch auf Nichtmartyrer aus. Zunächst waren es die großen heiligen Mönchsväter und Mönche, die liturgisch geehrt wurden (wie Paulus und Antonius im Morgenland, Martinus im Abendland); dann heilige Oberhirten, besonders Bischöfe, die für Christus und den Glauben, wenn auch nicht den Tod, so doch Verfolgung und Verbannung erduldet hatten; ihnen galt mit Vorzug der Ehrenname Confessores, Bekenner, der mit der Zeit weitere Ausdehnung erfuhr. Die ersten Anfänge der besonderen liturgischen Verehrung der Bekenner liegen schon in der Zeit des hl. Cyprian († 258) vor; dasselbe gilt von den Keimen der Verehrung gottgeweihter heiliger Jungfrauen an deren Spitze Maria, die Jungfrau der Jungfrauen, steht. Später wurde auch heiligen Witwen und Eheleuten liturgische Verehrung zuteil. Obwohl man die Engel schon sehr bald verehrte, kamen liturgische Feiern zu ihrer Ehre, besonders zu Ehren des Engelfürsten Michael, erst im 5. Jahrhundert auf.
Die Namen der gefeierten Heiligen wurden, nach den genau bestimmten Tagen der Festfeier geordnet, aufgezeichnet. Daraus entstanden die liturgischen Festkalendarien. Aus der Mutterkirche von Rom besitzen wir ein unvermischtes aus dem Jahre 354 und ein mit auswärtigen Heiligennamen vermischtes, das vielleicht noch 40 Jahre älter ist. Beide sind ehrwürdige Ahnen und Vorstufen unsres heutigen römischen Festkalenders der abendländischen Liturgie (Calendarium Romanum).
Abtei Mariawald
|